Der US-Staatshaushalt ist in Schieflage. Allein das Defizit des Jahres 2024 beläuft sich auf 1,83 Billionen US-Dollar, und auch im laufenden Jahr wurden bereits über 1,6 Billionen Dollar mehr ausgegeben als eingenommen wurden. Gemessen daran sind die Erträge von den Zöllen, die Präsident Donald Trump eingeführt hat, ein Klacks.
Und dennoch: Mit 13,4 Milliarden US-Dollar gehört die Schweiz nach der Zolleinführung vom August zu den Top-Zolleinnahmequellen des amerikanischen Fiskus. Dies haben die Ökonomen des Global Trade Alerts (GTA) berechnet, einer Organisation, die den weltweiten Handel laufend analysiert. Die folgende Tabelle zeigt, welches Land wie viel zu den US-Zolleinnahmen beiträgt. Annahme hinter der Rechnung ist: Das Handelsjahr 2024 wiederholt sich, aber mit den neuen Zöllen.
| Land | US-Zolleinnahmen in Milliarden US-Dollar |
| China | 189,1 |
| Mexiko | 63,0 |
| Japan | 26,7 |
| Kanada | 25,6 |
| Deutschland | 25,0 |
| Vietnam | 24,5 |
| Südkorea | 21,7 |
| Indien | 15,5 |
| Schweiz | 13,4 |
| Taiwan | 13,3 |
| Brasilien | 12,5 |
| Thailand | 11,3 |
| Italien | 10,4 |
| Frankreich | 8,1 |
| Grossbritannien | 7,7 |
| Malaysia | 5,8 |
| Indonesien | 5,1 |
| Niederlande | 3,0 |
| Spanien | 3,0 |
| Schweden | 2,8 |
US-Zolleinnahmen je Land in Milliarden US-Dollar. Quelle: Global Trade Alert.
Die Schweiz ist damit die für die USA einträglicherer Quelle als Frankreich und Italien, welche die zweit- beziehungsweise drittgrösste Volkswirtschaft der Europäischen Union sind und die je ein mehr als doppelt so hohes Bruttoinlandsprodukt wie die Schweiz haben.
Deutschland bringt den USA zwar die deutlich höheren Zolleinnahmen als die Schweiz - 25 gegenüber 13,4 Milliarden Dollar. Die absoluten Werte werden aufgrund der Grössenverhältnisse beider Länder aber relativiert. Die Wirtschaftsleistung Deutschlands ist fünfmal höher als jene der Schweiz. Entsprechend hoch erscheint die Summe, welche den Vereinigten Staaten aus der Schweiz zufliessen.
Die aus hiesiger Sicht wenig erbauliche Lage erklärt sich einerseits mit dem vergleichsweise hohen US-Handelsvolumen der Schweiz. Es ist beträgt 63 Milliarden Dollar. Deutschland kommt auf 159, Frankreich auf 59 und Italien auf 76 Milliarden Dollar.
Andererseits erklärt sich die Lage mit den unterschiedlich hohen Zöllen. Die Schweiz wurde mit einem Satz von 39 Prozent belastet, während die EU-Staaten Deutschland, Frankreich und Italien mit 15-Prozent-Zöllen versehen wurden. Doch dies ist wiederum nur ein Teil des umfassenderen Bildes. Denn das Zollsystem ist vielschichtig und kennt Ausnahmen. Vorerst ausgeklammert sind beispielsweise Pharmaprodukte.
Deshalb weichen die gewichteten, effektiven Zollraten von den angekündigten Sätzen ab, und auch diesbezüglich haben die Experten des Global Trade Alerts eine Analyse veröffentlicht. Konkret: Die Schweiz wird effektiv mit 21,3 Prozent belastet, Deutschland mit 15,7 Prozent, Italien mit 13,7 Prozent und Frankreich mit 13,6 Prozent. Insofern sind Schweizer Güter nicht so stark betroffen wie man angesichts des 39-Prozent-Hammers annehmen kann. Doch im Vergleich zu einem zollfreien Handel und im Vergleich mit den Erzeugnissen der europäischen Nachbarländer sind sie so oder so stärker tangiert.
Dieser Eindruck wird verstärkt, wenn man fragt, wie sich die Zollsätze auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes auswirken. Aufschlüsse dazu ergeben sich, indem man die Zollbelastung eines Landes mit den Sätzen der direkten Konkurrenten vergleicht und ins Verhältnis setzt. Die GTA-Analyse spricht vom «Relative Trump Tariff Advantage» - vom «Relativen Vorteil der Trump-Zölle».
Im Falle der Schweiz handelt es sich um einen Nachteil. Der entsprechende Wert: minus 12,1 Prozent. Das ist der preisliche Wettbewerbsnachteil der Schweiz gegenüber den Mitbewerbern und meint, dass sich der Zugang der Schweizer Unternehmen zum US-Markt entsprechend verschlechtert hat.
Ähnliches gilt beispielsweise für China; das Reich der Mitte hat den Berechnungen zufolge einen 29-prozentigen Nachteil. Handkehrum haben Deutschland (plus 1,4 Prozent), Frankreich (plus 0,5 Prozent) und Italien (2,4 Prozent) einen relativen Vorteil. Wichtig ist hier, dass es sich um eine Betrachtung von Verhältnissen unter den Ländern handelt - und es nicht darum geht, ob die USA beispielsweise Deutschland oder Italien einen absoluten Vorteil gegeben haben. Die Vorteile Deutschlands und Italiens ergeben sich aus dem Gefüge aller Zölle.
Die Momentaufnahme dürfte mit einiger Wahrscheinlichkeit keine in Stein gemeisselte Realität sein. Bewegung bringen können durch den US-Präsidenten abgesegnete Kursanpassungen oder auch die Reaktionen der Unternehmen auf die neue Situation. Weiter ist aus Schweizer Sicht etwa die Frage erheblich, ob, wann und in welchem Ausmass Zölle auf Pharmaprodukte kommen.
Unterschiedliche regionale Betroffenheit
US-Präsident Donald Trump hat zwar 39-Prozent-Zölle gegenüber der Schweiz eingeführt. Die einzelnen Landesgegenden sind aber unterschiedlich stark betroffen - je nachdem, wie stark die regionale Wirtschaft von Exporten in die USA abhängt.
Diesbezüglich hat die UBS eine Untersuchung veröffentlicht. Demnach dürften die negativen wirtschaftlichen Folgen der hohen Zölle «regional konzentriert ausfallen», wie Chefökonom Daniel Kalt schreibt.
Am stärksten betroffen seien die Regionen La Vallée, La- Chaux-de-Fonds und Val-de-Travers, die schweizweit den höchsten Anteil der Industriebeschäftigung aufweisen und zudem überproportional viel in die USA exportieren. Eine hohe US-Abhängigkeit der Exporte weisen Daniel Kalt zufolge auch die Regionen Fricktal, Neuenburg, Nidwalden und Basel-Stadt auf.
Grenchen, Rheintal, Werdenberg, Schaffhausen, Prättigau und Jura seien aufgrund der hohen Bedeutung der Industrie für die lokale Wirtschaft ebenfalls stark tangiert, obwohl ihr Anteil der Exporte in die USA geringer ausfalle.
Gegensteuern ist möglich, etwa durch Kurzarbeit. Sie soll Beschäftigungseinbrüche möglichst weitgehend verhindern. Die Option wurde vor allem während der Coronakrise genutzt, als phasenweise Hunderttausende - in der Spitze sogar über eine Million Arbeitnehmer - auf Kurzarbeit waren.


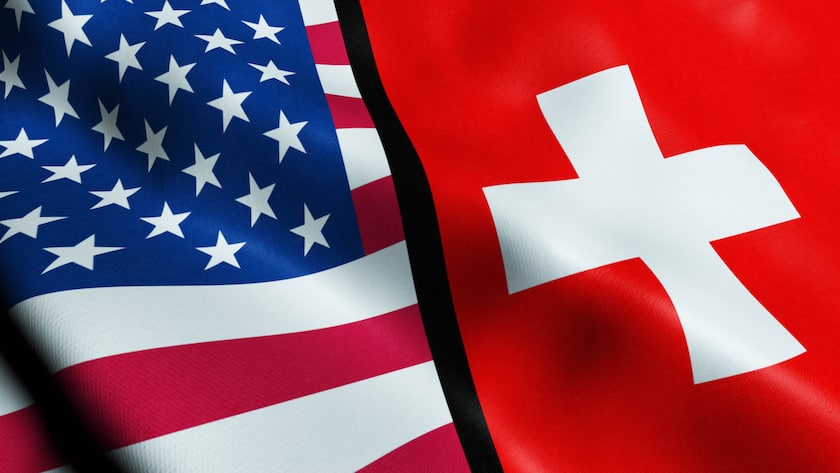
3 Kommentare
Die erwähnte Zusatz Zolleinnahmezahl-Zahl wäre also nicht für 20225 sondern für 1.08.25 bis 1.08.26 , kurz vor der Kongresswahlen. Und bei gleichbleibender Absatz in der US, was sicher nicht den Fall sein wird.
Trump wird davon nur traumen können.
Nach der Wahl wird dann eine Machtsausgleich erwarte, und 'lame duck' Trump, wenn nicht impeachement.
Es wäre nicht der erste Prresident die im zweiten Amtstermin abgeschossen wird. Sehr vielen halten gar nicht durch.
Wichtiger ist dass unsere Pharma doch nicht wieder im Schussfeld kommt aber auch deren Produktion kann leicht verlagert werden. In Basel ist die Grenze nicht weit weg.
Die betroffene Ausführen können umgeleitet werden, mit dem Luxus Uhrensegment wird es ohnehin so sein.
Wichtig ist auch das der Dollar nicht weiter fällt.
Der verteuert die US Importe für die Amerikaner zusätzlich, und führt generell zu weiteren Nachfragerückgängen.
Zur Impeachement könnte beitragen dass es sein könnte das die erste wahrgenommen Anzeichen einer Alters-Verwirrung bei Trump tatsächlich sich weiter entwickeln. Vielleicht sind diese Wahrnehmung aber nicht richtig interpretiert gewesen.
Bei Biden war es also Verstärkung seiner angeborene Sprach-Stammer Neigungen und vor Allem das Motorische. Bei Alzheimer gibt es oft bei Persönlichkeittypen wie Trump erst eine Trotz-Verneinfase, Trumps Hektik und Wahrheitsverneinende 'Fake' Gerede ähnelt auffällig dies, gefolgt durch noch schlimmere manische unredliche Agressionsausbrüche. Das wäre schlimm.
Die liebe Amerikanen wünsche ich den Kraft, nach all den Wirtschafts-Zerstörungen ihres Landes durch den Politikern, mit immer wieder neue Presidentendebakeln und beidseitige Blockierungen, endlich ihr politischen System im Dienste des Landes und ihre ganze Bevölkerung richtig zu gestalten zu können. Was leider ein grosser Umbruch wäre, und in ihre ganze Geschichte nie richtig gelungen ist.
Ich glaube nicht, dass diese Rechnung für die Schweiz stimmt, denn Gold- und Pharmaesporte in die USA werden nicht mit Zöllen belastet. Zudem haben viele Exporteure Lager in den USA aufgebaut und exportieren daher aktuell nichts. Ein paar Exportunternehmen werden nicht mehr in die USA liefern können, da sie nicht mehr konkurrenzfähig sind, etc. etc.
All das zeigt, dass die in diesem Artikel aufgeführte Zahl in keiner Weise der Wirklichkeit entsprechen wird.
Die Schweiz könnte 39%-Zoll beim Goldexport in die USA einführen. Dies würde das Problem der hohen US-Zölle bald lösen. Es braucht einzig Rückgrat von unserem Bundesrat. Aber ich denke, da wird vom BR zu viel erwartet.