In knapp vier Wochen ist es soweit: Am 28. September entscheidet das Schweizer Stimmvolk, ob es bei der Besteuerung von selbst genutztem Wohneigentum zu einem Systemwechsel kommt. Der offizielle Titel der Vorlage, «Bundesbeschluss über kantonale Steuern auf Zweitliegenschaften», ist ebenso sperrig und komplex wie die Ausgangslage selbst.
Heute gilt: Wer eine Wohnung oder ein Haus besitzt und selbst bewohnt, muss den sogenannten Eigenmietwert als Einkommen versteuern. Der Eigenmietwert entspricht dem Betrag, den Eigentümer erzielen könnten, wenn sie ihre Immobilie vermieten würden. Und das gilt sowohl für Erst- als auch Zweitliegenschaften.
Von der Schweizer Wohnbevölkerung wohnen rund ein Drittel in ihren eigenen vier Wänden. Und die sprechen beim Eigenmietwert oft von einer «fiktiven» und «unfairen» Steuer. Im Gegenzug dürfen Eigenheimbesitzende aber verschiedene Kosten steuerlich abziehen. Wie hoch die Steuer schlussendlich ausfällt hängt vom Kanton und vom Hypothekarzinsniveau ab. Bei hohen Zinsen zahlen Eigentümer mehr Steuern, was zu Mehreinnahmen für Bund, Kantone und Gemeinden führt - und bei tiefen Zinsen umgekehrt.
Würde der Eigenmietwert mit der Abstimmung nun abgeschafft und die Zinsen auf heutigem Niveau bleiben, dann gäbe es jährlich Steuerausfälle von rund 1,8 Milliarden Franken, schätzt der Bund. Um die zu kompensieren, zumindest teilweise, könnten Kantone aber künftig eine Sondersteuer auf Zweitwohnungen erheben.
Und darin liegt auch die Krux für die Stimmbevölkerung. Denn die Verfassungs- und Gesetzesänderung können nur gemeinsam in Kraft treten. Das heisst, nur wenn Volk und Stände der Sondersteuer auf Zweitliegenschaften zustimmen, fällt auch die Besteuerung des Eigenmietwerts weg.
Balance zwischen Mietenden und Eigentümer
Die ursprüngliche Idee hinter dem Eigenmietwert, eine Balance zwischen Mietenden und Eigentümerinnen und Eigentümer zu schaffen, birgt bereits seit Jahren politischen Zündstoff. Vor allem bei den Besitzern, die ihn mehrheitlich ablehnen und den Zweck infrage stellen. Das momentane Tiefzinsumfeld trifft Eigentümer stärker. Der Eigenmietwert bleibt unverändert, während die abziehbaren Hypothekarzinsen geschrumpft sind. Laut einer Analyse des Bundes würden deshalb heute rund 80 Prozent der Eigentümerinnen und Eigentümer von einer Abschaffung profitieren.
Gleichzeitig hat das System auch Vorteile für sie. Neben Schuldzinsen lassen sich Unterhalts- und Renovationskosten abziehen, eine Möglichkeit, die viele für die Steueroptimierung nutzen.
Kritiker sehen darin allerdings einen Fehlanreiz, da das System das Aufnehmen und Behalten von Hypotheken begünstigte und damit zur hohen privaten Verschuldung in der Schweiz beitrage. Im cash-Interview nahm Ökonom Marius Brühlhart die Vorlage unter die Lupe und erklärte, wer gewinnt und wer verliert.
Links-Grün gegen Bürgerliche
Politisch stehen SVP, Mitte und FDP hinter dem Systemwechsel. SP, Grüne und der Mieterverband halten am Status quo fest. Sie warnen vor Einnahmeausfällen und dem Ende einer funktionierenden Balance. Wie hoch die Mindereinnahmen ausfallen, hängt stark vom Zinsniveau ab: Je tiefer die Zinsen, desto grösser das Defizit. Auch die Kantone zeigen sich zurückhaltend. Zwar könnten insbesondere Bergkantone Ausfälle mit einer Zweitwohnungssteuer kompensieren, deren politische Durchsetzbarkeit gilt jedoch als unsicher. Banken lehnen den Wechsel ebenfalls ab, da das heutige System ihr Hypothekargeschäft stützt.
Hingegen in der Wirtschaft gehen die Meinungen auseinander. Das Baugewerbe profitiert eher vom bestehenden Modell, während der Hauseigentümerverband argumentiert, dass nach einer Abschaffung mehr Geld für den Unterhalt der Liegenschaften zur Verfügung stünde.


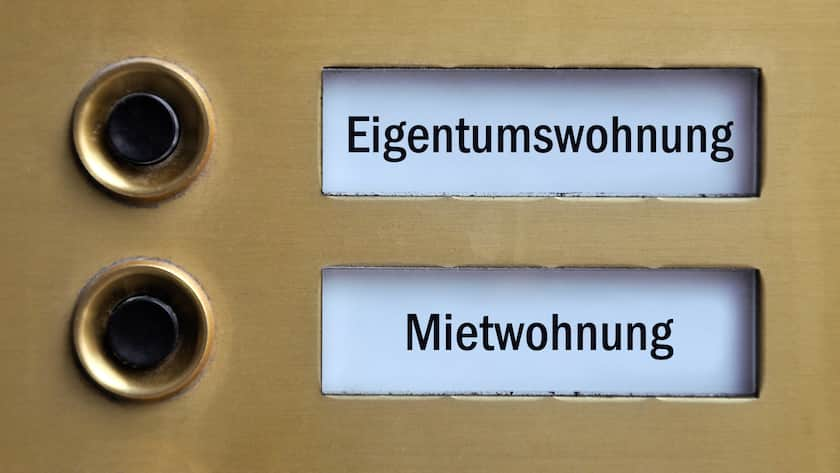
27 Kommentare
Die Befürworter der Eigenmietwert -Elimination sollten sich bewusst sein, dass die Steuern für alle, also vorwiegend für die Nichtbesitzer von Liegenschaften massiv steigen werden, weil das entstehende Loch gefüllt werden muss. Und das trifft ALLE und zwar massiv!!
Eigenmietwertbesteurung ist ein Riesenbüromonster.Über Pivatpersonen , Behörden bis nach Bern.Es kostet Nerven und Zeit und Geld.Deshalb verreinfachen wir dies mit einem Ja zur möglichen Objektsteuer von Zweitliegenschaften in den Kantonen mit einem Ja am 28.Sept.Lg Christoph Zehnder Eglisau
Das Riesenbüromonster entsteht erst recht durch die Abschaffung des Eigenmietwertes. Das Loch der Steuereinnahmen müsste ja gefüllt werden, liebe Nichtbesitzer von Wohneigentum! Denkt bitte nach und jubelt nicht zu früh.
Dass ich auf ein fiktives Einkommen, das ich effektiv nicht erziele, steuern bezahlen muss, ist doch an sich schon hanebüchen, deshalb gehört die Versteuerung des Eigenmietwertes abgeschafft. Zudem ist die Festlegung des Eigenmietwertes sehr spekulativ. Ich habe immer hart gearbeitet, verzichtet, gespart, jede Ausgabe abgewogen, damit ich mir eine Immobilie leisten kann; mein investiertes Geld wurde bereits einmal als Einkommen besteuert. Also what the heck??
Für die Vorlage sind u.a. die Verbände von Hauseigentümern. Also kann man davon ausgehen, dass Wohneigentümer sich finanzielle Erleichterungen / Vorteile versprechen. Die Konsequenz: Die Hürden für Wohneigentum verringern sich, es wird „günstiger“ und für mehr Leute bezahlbar. Marktgesetz: Höhere Nachfrage = höhere Preise. Rund zwei Drittel der CH–Bevölkerung sind Mieter. Für sie rückt der Traum vom Wohneigentum weiter in die Ferne, wenn Nachfrage und Preise steigen. Nebeneffekt: Bei steigenden Grundstückpreisen geht das Bauland eher an solvente Wohneigentümer als an Wohnbaugenossenschaften, die für Mietwohnungen sorgen. Folge: Es werden noch weniger Mietwohnungen gebaut und die Mietpreise klettern weiter. Als Mieter muss ich NEIN stimmen.
PS: Der Eigenmietwert wird als sogenannte Naturalien–Steuer bezeichnet. Ob diese Abgabe (wie vieles anderes auch) fair ist, sei dahingestellt. Man kann diese Steuer aber auch als Lenkungsmassnahme sehen, die eine Überhitzung des Liegenschaftsmarktes bremst. Es ist klar und unvermeidlich, dass es hier zu einem Interessenskonflikt kommt, aber wir zum Glück die Möglichkeit eines demokratischen Entscheidungsprozesses haben.